Haltung gegenüber Prüfungen
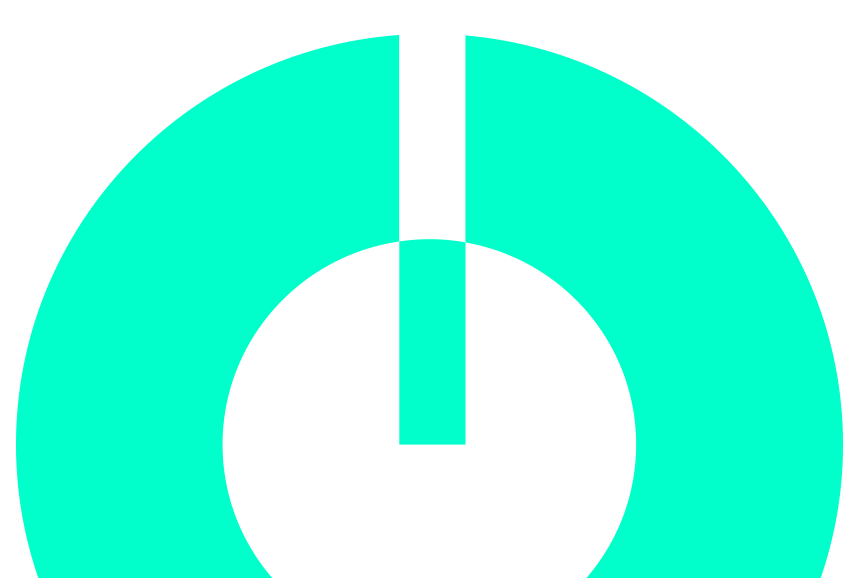
Prüfungen sind ein wichtiger Teil des Studiums, aber wie stehen Studierende und Lehrende zu ihnen? Wie können Prüfungen authentische Leistungen fördern und akademisches Fehlverhalten vermeiden? Wie kann die Chancengleichheit und Fairness bei Prüfungen gewährleistet werden? Und welche Rolle spielt die Haltung von Studierenden und Lehrenden zu Prüfungen?
Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des Arbeitspakets 3 „Haltung“, das von der Hochschule Neu-Ulm und der Technischen Hochschule Augsburg im ii.oo Projekt bearbeitet wird. Das Ziel ist es, eine Haltungsänderung bei Studierenden und Lehrenden zu Prüfungen zu bewirken, die im Sinne des selbstregulierenden Lernens und über Reflexion der eigenen Befähigung geschieht. Dabei sollen die Motivation zur Selbst- und Fremdtäuschung vermindert werden.
In nebenstehendem kurzem Screencast erfahren Sie mehr über das Arbeitspaket Haltung, seine Ziele, Methoden und Erkenntnisse. Schauen Sie rein und lassen Sie sich inspirieren!
Um diese Ziele zu erreichen, hat das Haltungs-Team eine theoretische Einordnung des Begriffs Haltung vorgenommen und Thesen zu den Faktoren formuliert, die die Haltung von Studierenden und Lehrenden zu Prüfungen beeinflussen. Diese Thesen wurden mithilfe leitfadengestützter, problemzentrierter Interviews überprüft, an denen sich rund 40 Lehrende und Studierende der Hochschule Neu-Ulm und der Technischen Hochschule Augsburg beteiligten.
Das Ergebnis ist eine Typologie mit jeweils vier Lehrenden- und Studierendentypen, die zentrale Handlungs- und Haltungsmuster differenziert abbildet.
